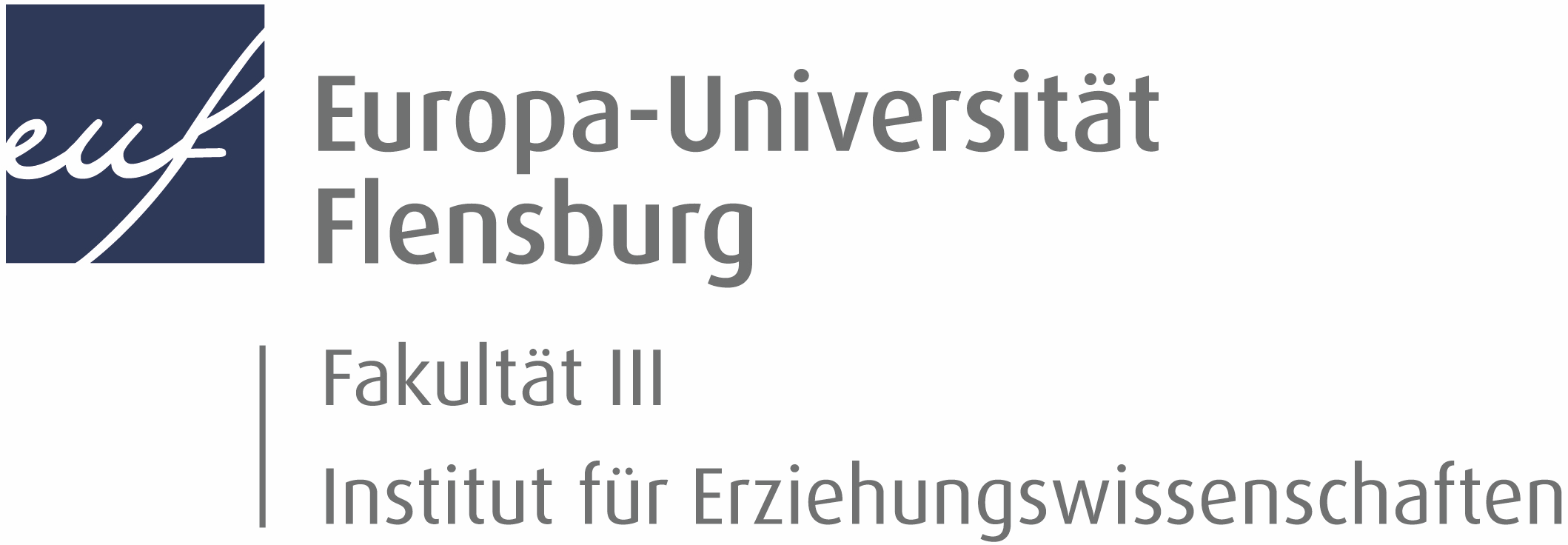Hausaufgaben sind in eine schulisch initiierte, aber in außerunterrichtliche Räume und Zeiten hineinreichende (Krinninger & Müller, 2020) Praxis eingebettet, in die neben den Schüler:innen und Lehrer:innen oft auch Eltern, andere Familienangehörige oder auch Nachhilfelehrer:innen einbezogen sind. Programmatisch wird – außer von einer didaktischen – von einer erzieherischen Funktion von Hausaufgaben ausgegangen (Kohler, 2017; Standop, 2013): Sie sollen zur Selbstständigkeit, zur Verantwortungsübernahme und zu einer konstruktiven Lern- und Arbeitshaltung erziehen (ebd., S. 51). Die beteiligten Erwachsenen sollen in einer „Erziehungs- und Bildungspartnerschaft“ von Schule und Elternhaus diese erziehenden Aufgaben übernehmen oder wenigstens unterstützen.
Aus praxistheoretischer Perspektive wird jenseits solcher Programmatiken nach Praktiken rund um Hausaufgaben gefragt (Fuhrmann, 2022; Nieswandt, 2014). Wir konzentrieren uns in diesem Symposium auf hausaufgabenbezogene Praktiken des Erziehens sowie des Wider-stands gegen und des Ausweichens vor Erziehungsan- und -zumutungen. Diese Praktiken wer-den im Sinne der Ethnomethodologie als Problem‘lösungen‘ praktischer Probleme verstanden, deren Ausprägungen und Bearbeitungen wir in drei Vorträgen herausarbeiten. Wir spüren außerdem der Frage nach, inwiefern und in welcher Art Erziehung im Kontext von Hausaufgaben zu beobachten ist, welche Positionen Lehrer:innen, Eltern und Nachhilfelehrer:innen einer-seits und die Schüler:innen/ Jugendlichen andererseits einnehmen und welche ‚Nebenwirkungen‘ die Praktiken haben. Übergreifend sollen Erziehungspraktiken rund um Hausaufgaben als Praktiken der Verschränkung von schulischer und familialer Erziehung diskutiert werden.
Theresa Klene: „Gelingen“ und „Scheitern“ von Erziehung aus praxistheoretischer Perspektive
Hausaufgaben tragen schulische Belange in die familiale Ordnung hinein (Krinninger & Müller 2020, S. 173). So können sie nicht nur eine vom Ort Schule entkoppelte erzieherische Wirkung entfalten, sondern verschränken zugleich schulische und familiale Erziehungspraktiken miteinander. Dies soll anhand zweier kontrastierender Fälle beleuchtet werden. Während im ersten Fall familiale Interaktionen zwischen Mutter und Schüler:in beim gemeinsamen Hausaufgabenmachen beschrieben werden – sich der Schullogik folgend also ein vermeintliches Gelingen zeigt –, stellt der zweite Fall das Verbleiben der Hausaufgaben in der Schule dar und verweist auf ein mögliches erzieherisches Scheitern. Durch die praxistheoretische Perspektive rücken nicht nur die erzieherischen Intentionen pädagogischer Programmatiken in den Blick, sondern auch die unerwarteten und ungewünschten Effekte von Erziehung, die in ihrer Vielfalt von Unterlaufen, Koexistenz, Umkehrung bis zum Scheitern reichen können (Budde, 2020).
Valentin Bähr: Häusliche Nachhilfe zwischen schulischer und familialer Erziehung
Die Normen und Prinzipien einer schulischen Erziehung können über die lokale Begrenzung der Schule hinaus wirken, was wir durch eine multi-sited Ethnography (Marcus, 1995) untersuchen. Dabei zeigt sich, wie in der häuslichen Nachhilfe innerhalb einer sozioökonomisch prekär positionierten Familie die familiale und schulische Dimension von Erziehung eng verflochten und gleichzeitig kontrastierend zueinander aufgestellt sind: So findet sie etwa im familialen Raum statt, bearbeitet aber familiale und schulische Anforderungen. Nachhilfekräfte sind weder ganz (schulische) Lehrperson noch Familienmitglied, gleichzeitig zeigen sich deutliche Aspekte von beiden Positionen. Zentral für den Beitrag ist die praxistheoretisch perspektivierte Frage, wie über die Nachhilfelehrerin (schulförmige) Erziehung beobachtbar (Budde, 2021) in das Feld der Familie gelangt, und wie sie dort wiederum von den verschiedenen familialen Akteur:innen sinngenerierend bearbeitet wird.
Nora Katenbrink: Abschreiben als Widerstand gegen oder als Resultat von Erziehung?
Das Abschreiben von Hausaufgaben kann als Widerstand gegen die erzieherischen Intentionen gedeutet werden. Die Ergebnisse einer Interviewstudie mit Schüler:innen (8. bis 13. Jahrgang unterschiedlicher Schulformen) zeigen, dass diese sich für Freizeitaktivitäten, Entspannung und Nichtstun entscheiden und durch das Abschreiben mögliche negative Sanktionen umgehen. Insbesondere rigide und sanktionsreiche Kontrollpraktiken von Lehrkräften führen eher zu vermehrtem Abschreiben als zur intensiven Bearbeitung der Hausaufgaben (Katenbrink & Kohler, 2024). Damit kann das Abschreiben auch als Resultat von Erziehung gesehen werden. Im Rahmen des Vortrags soll daher reflektiert werden, inwiefern Praktiken des Abschreibens von Schüler:innen die unmittelbare Verhaltenskontrolle durch Hausaufgaben und damit ein mögliches erzieherisches Anliegen des Unterrichts sowie den mehrdeutigen und diffusen Charakter von Hausaufgaben als Lern-, Erziehungs- und Selektionsanlass (Wernet, 2023) bearbeiten.