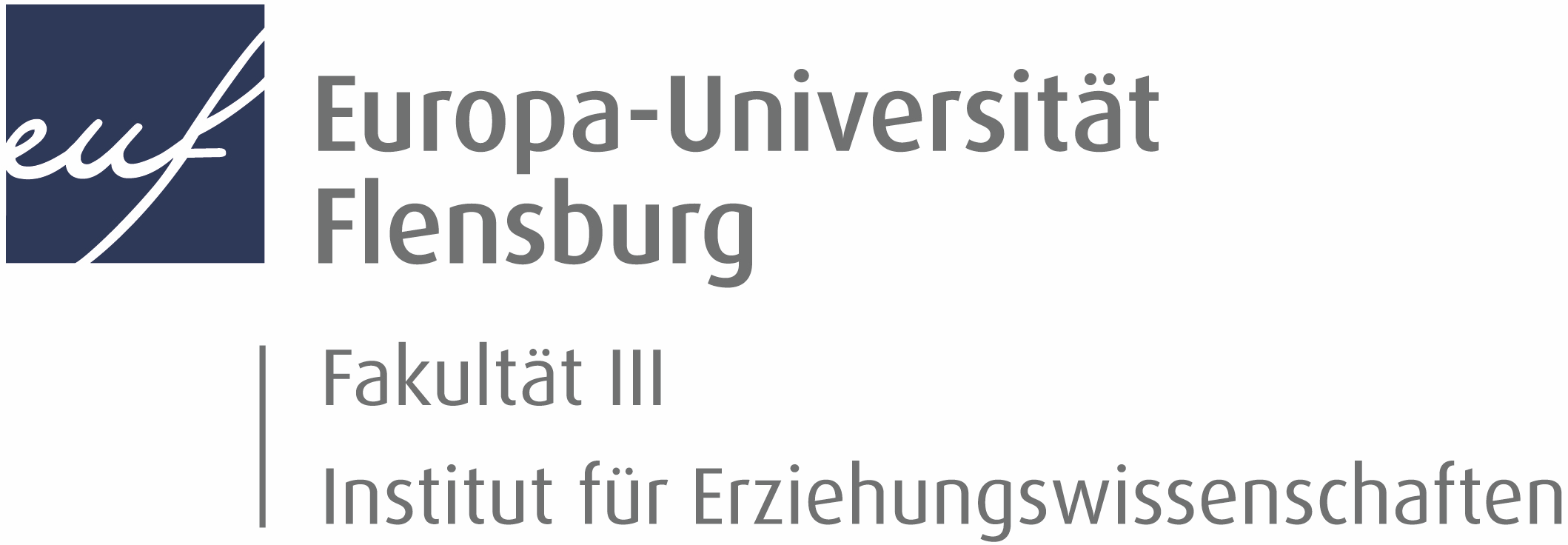Das Symposium stellt drei aktuelle Projekte zur Diskussion, die sich der empirischen Analyse von Erziehungspraktiken widmen, und möchte damit eine vergleichende Betrachtung der Praxis der Erziehung über die verschiedenen Stufen des deutschen Bildungssystems anregen. Die Projekte treffen sich trotz unterschiedlicher methodischer Herangehensweisen in ihrem grundlegenden Interesse an der konkreten interaktiven und situativen Prozessierung von „Erziehung“ im jeweiligen Feld. Dabei interessieren insbesondere die den Unterricht bzw. Kita-Alltag begleitenden, kleinen, eher beiläufigen Praktiken der Verhaltenssteuerung. Durch die vergleichende Diskussion der drei Projekte kommt die Spezifik der Erziehungspraxis auf der jeweiligen Stufe des Bildungssystems in den Blick: Im Elementarbereich erweist sich „Erziehung“ als das Kerngeschäft der Professionellen; im Primarbereich wird die Praxis der Erziehung von den Erfordernissen der Unterrichtsordnung aus entwickelt; im Sekundarbereich finden sich das Fachlehrer:innen-Prinzip und adoleszente Jugendliche – was bedeutet das jeweils für die Bedingungen und Grenzen institutioneller Erziehung?
In der übergreifenden Diskussion soll es darüber hinaus um grundlagentheoretische Fragen und begriffliche Klärungen gehen: Wie lässt sich „Erziehung“ als sensibilisierendes Konzept für empirische Forschung bestimmen und etwa von Disziplinierung oder Vermittlung unterscheiden? Wie lässt sich das Phänomen der Erziehung, das in der Regel anlassbezogen auftritt und zugleich über die Situation hinausweist, indem Haltungen und Orientierungen aufgebaut oder korrigiert werden, praxistheoretisch einholen? Welche Formen der Instrumentierung von Erziehung lassen sich beobachten? Welche Einsichten werden für eine Weiterentwicklung von Erziehungstheorien eröffnen die empirischen Studien?
1. Arnd Michael Nohl: Erziehung in Kindertagesstätten und ihre interaktive Einbettung
Obwohl seit dem PISA-Schock auch Kindertagesstätten vornehmlich als Orte der Bildung angesehen werden, finden sich in ihnen vielfältige Erziehungspraktiken – verstanden als nachhaltige und sanktionsbewehrte Zumutung von Orientierungen. Anhand von 63 Stunden videographierten Alltags in drei Kindertagesstätten ließ sich in einem DFG-Projekt mittels der Dokumentarischen Methode rekonstruieren, wie pädagogische Fachkräfte dann, wenn sich situativ Gelegenheiten bieten, Kinder proaktiv oder reaktiv erziehen (Nohl & Dehnavi 2023). Der Beitrag wird vor allem der Frage nachgehen, wie die Gruppenöffentlichkeit solcher erzieherischer Interaktionen mit deren Nachhaltigkeit verknüpft ist.
2. Georg Breidenstein: Erziehungspraktiken und Unterrichtsorganisation in der Grundschule
Ob es einen eigenständigen schulischen „Erziehungsauftrag“ geben kann und soll ist umstritten (Idel 2018). Zumindest so viel Erziehung aber scheint notwendig, dass die Voraussetzungen für Unterricht hergestellt und aufrecht erhalten werden können. Der Beitrag geht auf Feldforschungen zurück, die an vier kontrastierenden Grundschulen die jeweilige Erziehungspraxis in den Blick nehmen (Breidenstein 2025). Diese Schulen unterscheiden sich sehr deutlich hinsichtlich ihrer unterrichtsorganisatorischen Grundlagen sowie in dem Stellenwert, den sie dem erzieherischen Handeln zusprechen und wie sie die erzieherische Praxis instrumentieren. Die Kontraste der Schulen übergreifend soll systematisierend gefragt werden, wie sich die erzieherische Praxis der Grundschule zur Vermittlungsaufgabe des Unterrichts relationiert, wie sie mit der situativen Kontingenz der Anlässe für Erziehung umgeht und wie sie „Personen“ als Adressat:innen von Erziehung konstituiert.
3. Nele Kuhlmann & Anne Sophie Otzen: Erziehungspraktiken am Gymnasium – Anerkennungstheoretische Perspektiven
Ausgehend von einem Erziehungsverständnis, das zum einen die Operation des Zeigens (Prange 2005) und zum anderen die Moralität der Kommunikation betont (Oelkers 1992), untersucht der Beitrag unterrichtliche Erziehungspraktiken an einem Gymnasium. Die im Kontext eines DFG-Projekts videographierten Unterrichtsstunden werden daraufhin befragt, wie sich Erziehung als spezifisches Geschehen der Adressierung und Re-Adressierung situativ vollzieht, welche Normen der Anerkennbarkeit dabei relevant gemacht und welche Spannungen in der klassenöffentlichen Performanz greifbar werden (Kuhlmann & Otzen 2023). Dabei scheint insbesondere das für die Sekundarstufe relevante und erziehungstheoretisch kaum berücksichtigte Phänomen des ‚Gegenzeigens‘ von Schüler*innen interessant, das darin besteht, dass Schüler*innen auf die Legitimität der lehrpersonenseitigen Erziehung zeigen. Der Beitrag möchte diesen Aspekt pädagogischen Handelns erziehungstheoretisch diskutieren.